E-Mobilität spielt eine zentrale Rolle bei der Bekämpfung des Klimawandels. Der Umstieg auf umweltfreundliche Fortbewegungsmittel ist unabdinglich, um den CO2 Ausstoß zu senken und Klimaneutralität in Deutschland zu erreichen. Trotz dieses Bewusstseins und der stetig besser werdenden Infrastruktur scheuen Käufer zuletzt vermehrt vor elektrischen Fahrzeugen zurück und wählen lieber den Verbrenner.
Wieviele E-Autos gibt es in Deutschland?
In 2024 gab es insgesamt etwa 49,1 Millionen zugelassene PKWs. Von diesen waren 1,4 Millionen Elektrofahrzeuge. Der Anteil der E-Autos am Gesamtverkehr beträgt damit aktuell 2,9%. Das bedeutet, dass nur 2,9% der Kraftfahrzeuge elektrisch sind. Dennoch muss erwähnt werden, dass das E-Auto einen rasanten Aufstieg erlebt hat, da in 2021 nur 308 Tausend auf Deutschlands Straßen unterwegs waren. Während, vor allem 2023, ein sehr erfolgreiches Jahr für die E-Autobranche war (524 Tausend Neuzulassungen) ist dieser Trend wieder eingebrochen. Im Jahr 2024 gab es nur noch 380 Tausend Neuzulassungen und auch die Zahlen für 2025, 200.000 bis Ende Mai, werden wohl nicht mehr das Niveau von 2023 erreichen. Der Markt für E-Mobilität in Deutschland zeigt damit sowohl starkes Wachstum als auch Schwankungen, was die Entwicklung und Akzeptanz von Elektrofahrzeugen betrifft. Gründe, die für viele Menschen immer noch gegen ein E-Auto sprechen, sind unter anderem kurze Reichweiten und der Preis. Diese Probleme sind jedoch nicht unlösbar und technische Innovationen und Subventionen können Abhilfe schaffen. Elektrofahrzeuge nehmen bereits heute einen wichtigen Anteil des Individualverkehrs ein und werden in Zukunft eine noch größere Rolle für die Mobilität spielen. Im weiteren Verlauf werden wir Ihnen ein paar dieser Ideen und Hintergründe vorstellen. Hier erfahren Sie alles, was Sie über E-Mobilität wissen müssen.

In Deutschland gibt es insgesamt 166.867 Ladestationen, von denen 38.669 Schnellladestationen und 128.198 Normal-Ladestationen sind. Im Vergleich zu 2024 ist das ein Anstieg von 17%, denn damals gab es 142.336 Ladestationen. Die meisten Ladestationen stehen in Bayern, wo es 32.570 Stationen gibt. Den größten Ausbau von Ladestationen im Vergleich von 2024 und 2025 gab es in Bremen. Der Ladestation Bestand stieg um insgesamt 29% von 990 auf 1.280 Ladestationen. Diese Menge an Ladesäulen übertrifft den Bedarf. Im Schnitt waren in 2024 nur 17% der öffentlichen Ladepunkte gleichzeitig belegt und nur jeder fünfte Ladepunkt sei überdurchschnittlich ausgelastet, die anderen 4 hatten eine Auslastung von unter 17%. Weiter soll rund ein Viertel der Ladepunkte in Deutschland überhaupt nicht genutzt worden sein. Diese Umstände haben dazu geführt, dass der Ausbau von Ladestationen bereits gedrosselt wurde, da das Angebot schlicht nicht gegeben ist. Jedoch sehen Prognosen vor, dass die Ladestationen an Nutzen gewinnen, durch weitere E-Auto-Verkaufszahlen. Jedoch ist ein starkes Signal der Politik in Form von Subventionen oder anderen Maßnahmen gewünscht. Sorgen bezüglich der Infrastruktur sind daher unbegründet. Zudem dauert das Laden an Schnellladestationen lediglich 20 Minuten, welche als angenehme Pause für einen Kaffee oder einen kleinen Spaziergang angesehen werden kann.

Reichweite von E-Autos: Was ist möglich?
Die Reichweite ist für viele Interessierte ein zentrales Thema beim Kauf eines E-Autos. Moderne Elektrofahrzeuge bieten heute eine beeindruckende Bandbreite: Während kompakte Modelle wie der Renault Zoe mit einer Reichweite von unter 200 km auskommen, schaffen Premium-Modelle wie das Tesla Model S bereits 500 km und mehr mit einer Batterieladung. Die tatsächliche Reichweite hängt jedoch von verschiedenen Faktoren ab – etwa der Größe der Batterie, dem individuellen Fahrverhalten, der Nutzung von Klimaanlage oder Heizung und den aktuellen Wetterbedingungen. In Deutschland sorgt die stetig wachsende Ladeinfrastruktur dafür, dass auch längere Strecken mit dem E-Auto problemlos möglich sind. Überall im Land finden sich Ladestationen, an denen das Fahrzeug schnell und bequem aufgeladen werden kann. So wird die Reichweite immer weniger zum Hindernis für die Elektromobilität und die Mobilitätswende.
Warum ist der Trend rückläufig?
Vorerst, um die rückläufigen Nummern einzuordnen, muss erwähnt werden, dass die Kaufzahlen an PKWs generell zurückgingen. Im Vergleich wurden 2024 2,8 Millionen PKWs weniger zugelassen als in 2023. Beim E-Auto gab es noch weitere externe Faktoren, die dafür sorgten, dass die Anzahl der Neuzulassungen sank. 2023 lief die direkte Prämie für den Kauf eines E-Autos aus. Diese sah folgendes vor:
-
Elektroautos bis 40.000 euro: 6.750 Euro Förderung
-
Elektroautos von 40.000 bis 65.000 Euro: 4.500 Euro Förderung
-
Junge Gebrauchtwagen bis 65.000: 4.500 Euro Förderung
Nach dem Wegfall dieser Förderungen brachen die Verkaufszahlen drastisch ein und das Interesse an E-Autos schwand.
Mögliche Subventionen
Eine neue Förderung ist geplant, jedoch wurde noch nichts beschlossen. Die Bundesregierung arbeitet derzeit an einem neuen Förderprogramm, das gezielt die Entwicklung und den Ausbau der Elektromobilität unterstützen soll. Ziel dieser Maßnahmen ist es, die Ladeinfrastruktur weiter auszubauen und die Markteinführung innovativer Technologien wie das bidirektionale Laden zu beschleunigen. Die Ziele der neuen Förderungen bestehen darin, den Markt für E-Mobilität zu stärken, die Marktfähigkeit neuer Technologien zu fördern und attraktive Angebote für Verbraucher zu schaffen. Im Rahmen des geplanten Förderprogramms werden voraussichtlich spezielle Angebote für verschiedene Zielgruppen bereitgestellt, um den Umstieg auf E-Autos noch attraktiver zu machen.
Teil dieser neuen Förderungen könnten die folgenden Initiativen sein:
-
Social Leasing: Ein Leasingprogramm, das durch staatliche Förderungen günstige monatliche Raten für ein E-Auto anbietet. Dieses würde auf mittlere sowie niedrige Einkommen abzielen. Als Vorbild wird Frankreich gesehen, wo es dieses Modell bereits gibt und Menschen mit niedrigem Einkommen ein E-Auto für 100 Euro im Monat leasen können.
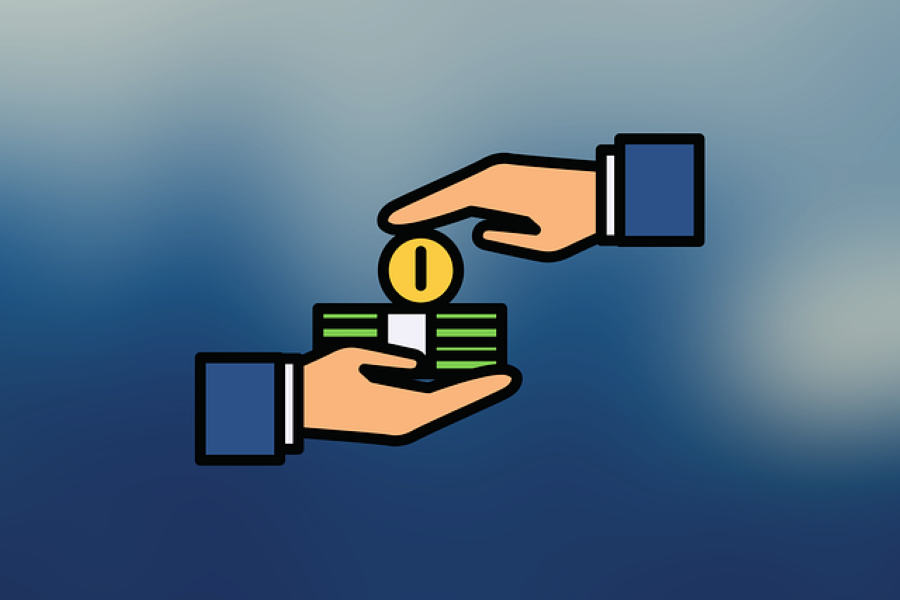
Akutelle Subventionen
Momentan erhalten E-Autos folgende Subventionen: KFZ-Steuerbefreiung, THG-Quote und Steuervorteile.
-
Die KFZ-Steuerbefreiung gilt ab der Erstzulassung für maximal zehn Jahre. Hierbei gilt: Je schwerer das Auto, desto größer die Ersparnisse.
-
Die THG Quote (Treibhausgasminderungsquote) kann in Zusatzeinnahmen von bis zu 80 Euro pro Jahr einbringen.
-
Wenn E-Autos auf der Arbeit geladen werden, ist diese Leistung von der Lohnsteuer und von Sozialabgaben befreit.
Attraktiv durch Innovation
Durch die Weiterentwicklung von E-Autos könnte das Interesse an ihnen wieder gesteigert werden. Zum einen gibt es hier die Weiterentwicklung im Bereich der elektrischen LKWs. Dieser Schritt könnte für eine noch bessere Infrastruktur sorgen und das gesellschaftliche Interesse wieder auf dieses Thema lenken. Zudem muss die Batterie für solch ein Vorhaben weiterentwickelt werden, um möglichst lange Strecken zurückzulegen.
Zum anderen laufen im Moment die ersten Tests für induktives Laden auf Autobahnen. In Bayern, auf der A6, sowie in Frankreich, auf der A10 wurden je 1 km und 1,5 km lange Streckenabschnitte umgebaut. Induktionsspulen wurden in der Autobahn verbaut, die durch elektromagnetische Felder die Energie an die Empfängerspule übertragen. Man kann es sich ähnlich vorstellen, wie kontaktloses Laden mit dem Handy. Diese Technologie könnte das Reichweitenproblem nachhaltig lösen und dafür sorgen, dass beim Fahren geladen werden kann. Die Technologie wurde im Rahmen früherer Tests soweit optimiert, dass sie eine Effizienz von 90 % Energieübertragung erreicht. Neben der Lösung des Reichweiten-Problemes würden die E-Autos auch günstiger werden. Die Batterie könnte um bis zu 70% verringert werden, was das Auto leichter und kostengünstiger machen würde. Zudem erhöht es Komfort und Zeiteffizienz. Auch für den ÖPNV könnte das revolutionär sein. E-Busse könnten während der Fahrt laden und müssten nicht für längere Zeit aus dem Verkehr gezogen werden. Jedoch gibt es auch negative Seiten. Die Kosten, um induktives Laden flächendeckend umzusetzen, wären enorm. Hinzu kommt, dass es keinen weltweiten Standard gibt, was von Nöten wäre, damit Hersteller sich besser darauf einstellen können.
